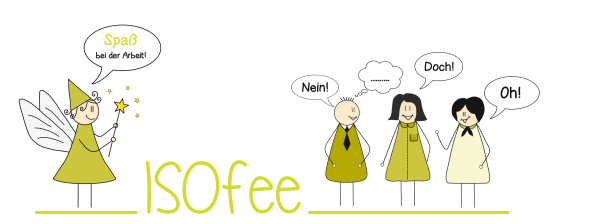Ich muss das noch fertig bekommen. Du musst mir mal helfen. Jemand sollte das mal ändern. Ich würde so gerne nach Bali fliegen. Du könntest mich ja mal unterstützen. Ich hätte das anders machen sollen. Wir sollten uns mal wieder treffen. Kommen Ihnen diese Sätze irgendwie bekannt vor? Es würde mich stark wundern, wenn nicht. Denn der Mensch ist ein Meister der Manipulation, vor allem der Selbstmanipulation. Müssen, Aber, Sollte, Man, Könnte, Würde, so viele Konjunktive, so viele (scheinbare) Pflichten und Ansprüche, denen wir hinterherlaufen und gerecht werden wollen.
Die Vergangenheit ist vergangen und wir können sie nicht ändern, Zeitreisen sind noch nicht erfunden. Trotzdem schaffen wir es, ständig in unserer Vergangenheit zu leben. Wir schleppen unsere gemachten Erfahrungen, unsere getroffenen Entscheidungen, unsere positiven und schmerzhaften Erinnerungen wie in einem voll beladenen Bollerwagen hinter uns her.
In diesen Wagen packen wir fleißig weiter all unser Erleben hinein, während sein Gewicht unmerklich, aber beständig immer weiter zunimmt. Wollen wir mit diesem voll beladenem Bollerwagen nun einen Gipfel erklimmen, zieht er uns mit all seiner potenziellen Energie zurück und wir kommen nur schwer voran. Geht es bergab, scheint uns der Wagen mit seiner Masse förmlich zu überrollen. Halten wir nicht dagegen, reißt er uns immer weiter in die Tiefe. Unser Hirn sagt in diesen Momenten häufig „Habe ich es nicht gesagt? Ich schaffe es eh nicht!“.

Doch wieso fällt es uns so schwer, Ballast aus unserem Bollerwagen zu werfen oder ihn ganz loszulassen? Das menschliche Gehirn ist ein kleiner Junkie und hält gerne an alten, bekannten Dingen und Programmierungen fest. Wir denken von Natur aus in der Vergangenheit und vergleichen ständig mit zurückliegenden Momenten und Erfahrungen. Sie sind unsere Referenzwerte, sie sind das für uns sichere und universell gültige. Unser Gehirn ist eine lebende Aufzeichnung der Vergangenheit und spiegelt alles wieder, was wir wissen und bisher erlebt haben. Schauen wir damit in unser kommendes Leben, können wir uns nur schwerlich eine wirklich neue Zukunft kreieren. Stattdessen schafft unser Unterbewusstsein den Transfer vom Vergangenen und vertritt den Standpunkt, dass das gleiche Ergebnis nochmal geschehen wird. Wir klammern uns unbemerkt an die Emotionen der Vergangenheit und sagen uns unbewusst mit ihr unsere eigene Zukunft voraus. Durch Sätze wie „Das werde ich nie lernen“, „Meine ganze Familie kann kein Mathe“ oder „Davor werde ich immer Angst haben“ haben wir Glaubenssätze in unser System integriert, die eine trügerische Orientierung für neue Erlebnisse bilden.
Wir leben in einer Art Vergangenheits-Autopilot. Das hat natürlich seine Vorteile, denn im Bekannten schwingt eine Bequemlichkeit mit, das Mühelose, das Automatische, unser altbekanntes Ich. Unser Gehirn kann so die ständig auf uns einströmenden Reize besser verwerten und schneller in bekannte Schubladen sortieren. Damit aber findet unser Identitätsverständnis in der Vergangenheit statt. Täglich beschäftigen wir uns mit zigtausenden Gedanken, wovon rund 90 Prozent jeden Tag die gleichen sind und sich auch in unseren Handlungen widerspiegeln. Wir verlassen auf derselben Seite das Bett, haben die gleiche Morgenroutine im Badezimmer, machen uns das gleiche Frühstück, sitzen auf demselben Stuhl am Tisch, fahren dieselbe Strecke zur Arbeit zu denselben Menschen und Kollegen. Ähnliche Routinen kennen Sie bestimmt auch an ihrem Arbeitsplatz oder in ihrer Freizeit nach der Arbeit.
Eben solche ständigen Wiederholungen und Routinen finden sich auch in unserer Sprache wieder. Die oben erwähnten Worte kennen die meisten von uns schon aus ihrer Kindheit und Schulzeit. „Du musst noch die Hausaufgaben machen“, „Man merkt, dass du nervös warst“ oder „Dein Vortrag war super, aber darauf hättest du noch mehr eingehen können“ sind für mich zumindest typische Sätze aus der Schule. In diesen Sätzen verstecken sich drei kleine Worte mit großer Macht: Müssen, Man und Aber.
Hinter dem Wort Müssen steckt immer eine Konsequenz, also eine mögliche oder zwingende Folgerung. Wenn die Hausaufgaben beispielsweise nicht gemacht werden, ist eine Folgerung ein Eintrag ins Klassenbuch, was zu weiteren Konsequenzen führen kann. Das Gehirn kategorisiert Müssen-Sätze passend zu vergangenen Erfahrungen und fürchtet eine erneute negative Konsequenz. Wenn Sie zum Beispiel das nächste mal zu sich selbst sagen „Ich muss das noch fertig bekommen!“, stellen Sie sich einmal die Fragen: Muss ich wirklich oder will ich es? Was würde passieren, wenn ich es nicht fertig bekomme? Geht davon die Welt unter oder ist es höchstens unangenehm? Wenn ich deshalb natürlich gefeuert werde, ist das eine weitreichende Konsequenz. Doch zu gerne setzen wir uns selbst mit einem scheinbaren Müssen unter Druck und fügen uns selbst produzierten Stress zu.
Das Wörtchen Man ist wohl eines der inflationärsten Worte unseres Sprachgebrauches. Als Generalpronomen der deutschen Sprache nutzen wir es ständig und für alles mögliche (Bsp.: „Man gönnt sich ja sonst nichts“ oder „Das sieht man doch“). Achten Sie die nächsten Tage mal darauf, wie oft es die Menschen in Ihrem Umfeld nutzen oder wann Sie es selbst gebrauchen. Gerade diese Generalisierung führt in direkten Gesprächen dazu, dass wir unsere eigene Meinung und Haltung hinter dem Allgemeinen verstecken. Bei Feedback hält es davon ab, wirklich persönliche und konstruktive Rückmeldung zu geben. Sätze wie „Man merkt, wie nervös du warst“ sind doppelt gefährlich. Hier wird impliziert, dass jeder (im Raum, in der Videokonferenz, in der Firma…) das so sieht, obwohl es nur die eigene subjektive Wahrnehmung ist. Außerdem können wir nur das interpretieren, was wir wahrnehmen. In diesem Fall die äußeren Anzeichen, die wir mit Nervosität verbinden (wie brüchige Stimme, Schwitzen, zitternde Hände, Rötung des Gesichts, zusammenhangslose Sätze usw.). Passender im Feedback wäre ein Satz wie „Ich habe wahrgenommen, dass du eine etwas brüchige Stimme hattest und deine Hände stark gezittert haben, was auf mich einen nervösen Eindruck machte“. Merken Sie den Unterschied? Dass es für ein Feedback ein nicht förderlicher Satz ist, sollte aber auch klar sein. In der Regel wissen die Sprecher selbst am besten, wenn sie nervös sind. Über konstruktives Feedback können Sie in unserem Beitrag „Selbst- und Fremdwahrnehmung“ noch weiteres erfahren.

Ähnlich verhält es sich mit dem Wort Aber. Worauf richtet sich bei dem Satz „Dein Vortrag war super, aber darauf hättest du noch mehr eingehen können“ Ihre Aufmerksamkeit? Sehr wahrscheinlich darauf, dass Sie etwas noch hätten besser machen können. Dass Ihr Vortrag ansonsten super war, wird quasi ausgeblendet. Ein Satz kann noch so viele positive Aspekte enthalten, wenn die Kritikpunkte zum Schluss mit einem Aber eingeleitet werden, liegt der Fokus vom Gehirn des Feedbackempfängers komplett in der Defizitorientierung.
Weniger negative Schärfe hat die Formulierung „Dein Vortrag war super. Bei dem einen Punkt hat mir nur noch eine genauere Ausführung gefehlt“. Wie sehr das kleine Wörtchen Aber in unserem alltäglichen Sprachgebrauch verankert ist, können Sie in der nächsten Zeit ja mal beobachten.
Natürlich gibt es Momente in unserer Sprache, wo jedes dieser Worte Sinn ergibt und angebracht ist. Jedoch schadet es nicht, seinen eigenen Sprachgebrauch ab und an zu hinterfragen und zu schauen, was wir da eigentlich zu uns und anderen sagen. Machen Sie sich bewusst, dass jedes Wort einen Einfluss auf unsere Mitmenschen und uns selbst hat. Durch bewusste Formulierungen können wir uns selbst das Leben angenehmer machen, unseren Mitmenschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und wahrhaftig miteinander kommunizieren.
Aber muss man jetzt jeden Satz analysieren? (Na, bemerkt?) Natürlich nicht, doch die bewusste Wahrnehmung von Kommunikationsdetails ermöglicht eine nachhaltige Veränderung. Ansonsten bleiben wir in unserem Vergangenheitsmodus. Wir durchleben wieder und wieder dieselben Gefühle und Gedanken, wenn wir die Worte hören oder sprechen. Also könnten die Schritte für eine Veränderung lauten: wahrnehmen, bewerten, anpassen. Damit können wir ein wenig alten Ballast aus unserem Bollerwagen werfen und einige Wege leichter beschreiten. Denn am Ende des Tages gibt es kaum etwas angenehmeres, als zufrieden und glücklich mit sich selbst und seiner Umwelt zu sein und mit einem Lächeln einzuschlafen.